Kontinent der Chancen
Eine breit angelegte Kooperation aus Unternehmen und Organisationen engagiert sich in Marokko für den Ausbau der Elektro- und Digitalindustrie in Afrika.
ampere 1.2024
Mein Gadget
Julia Dornwald plädiert für die Teilnahme an der Europawahl. Denn für eine gute Politik braucht es einen breiten Wählerwillen, sagt die Geschäftsführerin der ZVEI-Landesstelle NRW und Referentin im ZVEI-Fachverband Kabel und Isolierte Drähte.
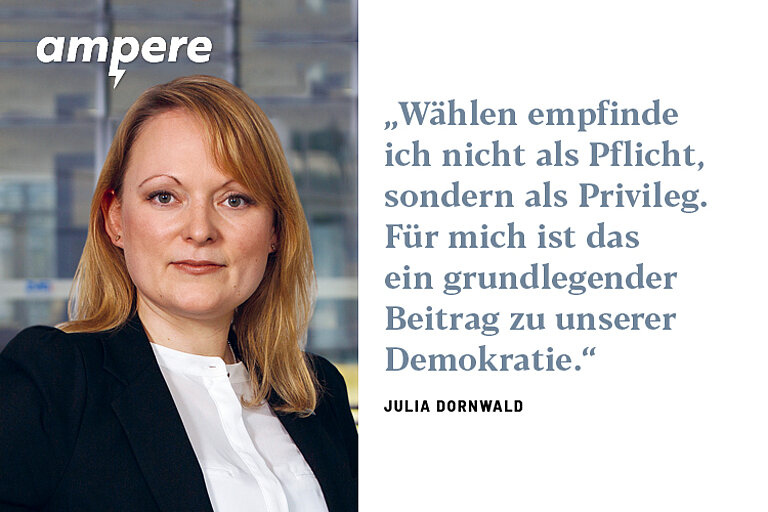
Seitdem ich wählen darf, gehe ich an den jeweiligen Sonntagen ins Wahllokal. Ich möchte den Stimmzettel bewusst in die Wahlurne werfen. Für mich ist das ein grundlegender Beitrag zu unserer Demokratie, für den ich mich danach mit einem Spaziergang und einem Eis belohne. Das Wählen empfinde ich allerdings nicht als Pflicht, sondern als Privileg. Wir sollten nicht vergessen, dass dies nicht selbstverständlich ist. Politikerinnen und Politiker, die den Rahmen vorgeben, sollten von breiten Teilen der Bevölkerung gewählt werden. Die Europawahl ist auch aus beruflicher Sicht sehr spannend. Die meisten Unternehmen im ZVEI sind international tätig. Wir haben in Europa einen gemeinsamen Markt, rekrutieren dort Beschäftigte, vertreten dieselben Werte. Das zu erhalten, ist besonders wichtig. Und wählen zu gehen, ist ein Grundbaustein dafür.
Expertenwissen
Die Europäische Union wird den Strommarkt reformieren. An welchen Stellschrauben gedreht werden soll, um mehr Flexibilität im Stromsystem zu erreichen, erklärt Mark Becker-von Bredow, Bereichsleiter Elektrifizierung und Klima beim ZVEI.
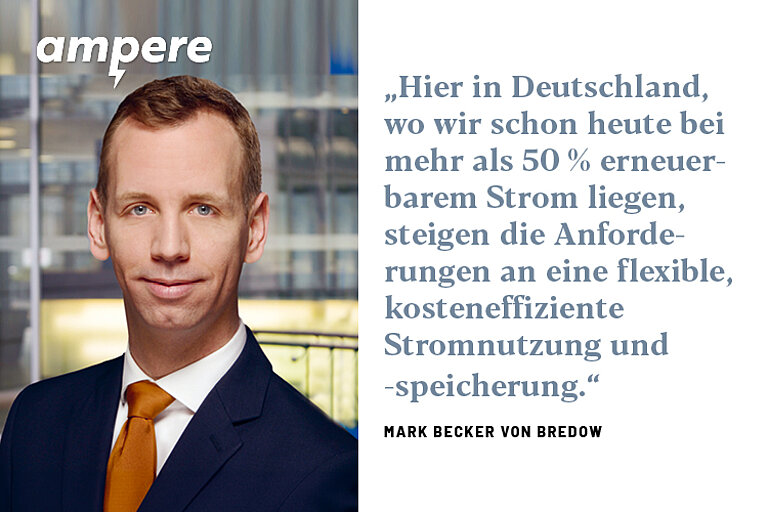
Kommission, Rat und Parlament der EU haben sich auf eine Reform des Strommarkts geeinigt. Neben industriepolitischen Fragen wurde richtigerweise auch Augenmerk auf bessere Rahmenbedingungen für das Zusammenspiel von Stromangebot und -nachfrage gelegt. Den wirtschaftlichen Mehrwert dezentraler Flexibilität hat der ZVEI gemeinsam mit der Neon – Neue Energieökonomik GmbH in einer kürzlich veröffentlichten Studie nachgewiesen. Gerade hier in Deutschland, wo wir schon heute bei mehr als 50 Prozent erneuerbarem Strom liegen, steigen die Anforderungen an eine flexible und damit kosteneffiziente Nutzung und Speicherung von Strom. Mit dem gefundenen Kompromiss bleiben erstens die flexiblen Stromtarife erhalten, die die notwendigen Preissignale an die Stromkunden übermitteln. Einen positiven Schub soll es zweitens beim Energie-Sharing geben. Kleinere Erzeuger sollen unbürokratisch überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energien mit anderen teilen können. Und drittens: Nicht nur in Deutschland wurde bisher der Ansatz verfolgt, die Versorgungssicherheit bei Nachfragespitzen insbesondere durch zusätzliche Erzeugungsanlagen sicherzustellen. Mit dem Demand-Response-Ansatz werden nun die EU-Mitgliedstaaten angehalten, die intelligente Steuerung der Stromnachfrage und die Integration von Stromspeichern systemisch weiterzuentwickeln, um diesen Nachfragespitzen zu begegnen.
Meilenstein
Der Europäische Wirtschaftsraum ist eine Freihandelszone zwischen 30 Staaten mit rund 520 Millionen Einwohnern.

Vor 30 Jahren wurde der Europäische Wirtschaftsraum (EWR; englisch: European Economic Area, EEA) geboren – ein Jahr, nachdem der europäische Binnenmarkt das Licht der Welt erblickt hat. EWR-Mitglieder sind heute einerseits die 27 EU-Staaten, andererseits Island, Liechtenstein und Norwegen. Sie alle bilden einen gemeinsamen Markt mit ungefähr 520 Millionen Einwohnern. Im EWR wurden die Zölle zwischen den Mitgliedstaaten abgeschafft, außerdem gelten dort rund 80 Prozent der Binnenmarktvorschriften der EU. Kernelemente des EWR sind ein freier Personen-, Waren- und Kapitalverkehr sowie die Zusammenarbeit in Fragen des Verkehrs, der Landwirtschaft, der Fischerei, des Handels und der Energie. Verschiedene Organe sind für die Umsetzung des EWR-Vertrags verantwortlich, darunter der EWR-Rat, der sich aus Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten zusammensetzt. Im Gegensatz zu Island, Liechtenstein und Norwegen regelt die Schweiz ihre Beziehungen zur EU über bilaterale Abkommen.
Schaltzeichen
Die beiden Buchstaben CE stehen für „Conformité Européenne“, was „Europäische Konformität“ bedeutet.

Jeder kennt dieses Logo, das sich auf unzähligen Produkten findet. Kein Wunder: Viele Waren dürften ohne die CE-Kennzeichnung in der EU überhaupt nicht vermarktet werden. Sie ist ein Hinweis darauf, dass ein Produkt vom Hersteller in eigener Verantwortung geprüft wurde und dass es alle EU-weiten Anforderungen an Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz erfüllt. Das CE-Zeichen bedeutet aber nicht, dass die EU oder eine andere Organisation wie beispielsweise der TÜV das Produkt als sicher bewertet haben. Die CE-Kennzeichnung wurde 1985 mit einer Entschließung des damaligen EG-Rates eingeführt.
Übrigens: Das CE-Kennzeichen wird wegen seiner Bedeutung immer wieder gefälscht. Dabei ist es präzise definiert. Falsch wäre zum Beispiel ein „E“, dessen Mittelstrich auf einer Linie mit dem oberen und unteren Ende des Buchstabens liegt.
Graphiken von oben nach unten: Barbara Geising | ZVEI/ Maren Strehlau | shutterstock.com/Eugene B-sov | Barbara Geising | ZVEI/ Maren Strehlau
Dieser Text ist in der Ausgabe 1.2024 der ampere am 15. April 2024 erschienen.
Eine breit angelegte Kooperation aus Unternehmen und Organisationen engagiert sich in Marokko für den Ausbau der Elektro- und Digitalindustrie in Afrika.
Der Business Council for Democracy bietet Hilfestellungen gegen Hassrede, gezielte Desinformation und Verschwörungserzählungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an. So kann auch die Wirtschaft einen Beitrag leisten, um die Demokratie zu stärken.
Zum Jahresbeginn ist die BRICS-Gruppe um fünf weitere Mitglieder gewachsen. Ihr Anteil an der Wirtschaftsleistung wächst damit weiter. Aber auch bei den Patenten und dem MINT-Nachwuchs verschieben sich die Gewichte zusehends.
Industrial 5G hält derzeit Einzug in immer mehr Fabrikhallen. Die Funktechnik kann zu einem wichtigen Baustein für die Smart Factory werden – auch dank der ZVEI-Arbeitsgemeinschaft 5G-ACIA.
28.884 Friedenstage wird es in den Ländern der EU zwischen dem Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945 und dem Start der Europawahl am 6. Juni 2024 gegeben haben.
ampere
Mit dem Magazin der Elektro- und Digitalindustrie ampere, das zwei Mal im Jahr erscheint, schaut der Verband über den Tellerrand der Branche hinaus.
Jede Ausgabe von ampere setzt sich kontrovers und informativ mit Themenschwerpunkten der Elektroindustrie auseinander, die aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet werden. Der Verband will mit dem Magazin den Dialog mit Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft stärken.